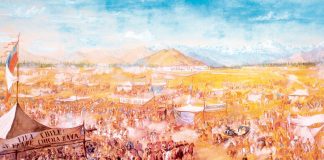Wagner neu entdecken
2026 es un año especial para los wagnerianos: el Festival de Bayreuth celebra su 150.º aniversario, y al mismo tiempo, el ciclo de ópera «El anillo del Nibelungo» («Der Ring der Nibelungen») de Richard Wagner cumple 150 años desde su estreno en los primeros festivales en 1876. ¿Por qué sigue fascinando, polarizando e inspirando este artista alemán del siglo XIX hasta hoy? Con nuestra nueva serie, Claudio Ortiz, de la Fundación Richard Wagner, invita a redescubrir a Wagner: como una figura compleja de la historia cultural, filósofo, escritor y visionario, cuya obra y persona siguen cautivando a la gente hasta la actualidad.

Claudio Ortiz ist ein großer Liebhaber klassischer Musik, besonders der Werke Richard Wagners. Er ist Mitglied mehrerer Richard-Wagner-Verbände in Deutschland, Spanien und Argentinien und war zuletzt Vizepräsident des Kölner Verbandes. Von 2019 bis 2024 gehörte er dem Präsidium des Richard-Wagner-Verband-International an, der 127 Verbände weltweit vereint. Zudem ist er Ehrenmitglied der Richard-Wagner-Stiftung Chiles.
Er gründete die YouTube-Kanäle «Descubriendo la Música Clásica» und «Discussing Richard Wagner», in denen er klassische Musik vermittelt und Interviews mit Sängern, Dirigenten, Regisseuren, Historikern und Musikwissenschaftlern führt.
Claudio Ortiz ist verheiratet, Vater von zwei Kindern und von Beruf Tierarzt. Seine Tätigkeit in einem deutschen Pharmakonzern führte ihn zunächst nach Deutschland, dann nach Argentinien und auf die Philippinen, bevor er 2001 endgültig nach Deutschland zurückkehrte, wo er seitdem wohnhaft ist.
Teil 1 Richard Wager
Der Meister des Gesamtkunstwerks
Von Claudio Ortiz
La influencia de Richard Wagner se extendió mucho más allá de la música. En las próximas publicaciones se abordarán diversos aspectos de su vida y obra: desde su agitada existencia, que incluyó una infancia turbulenta y dolorosa, pasando por una asombrosa cantidad de viajes por Europa, innumerables enfermedades, fracasos personales y profesionales que solo estimularon su espíritu y su voluntad de triunfar, hasta sus revolucionarias ideas estéticas y su impacto en la historia de la ópera, así como las complejas dimensiones filosóficas, políticas y literarias de su legado.
Faszinierend, komplex und umstritten
Jeder zukünftige Beitrag wird einem anderen Thema gewidmet sein: seiner musikalischen Entwicklung, Kommentaren zu seinen Werken, seinen theoretischen Texten, seiner Beziehung zu Schopenhauer und Nietzsche, seinem Vorstoß in die Psychologie mit Theorien, die Sigmund Freud und Carl Gustav Jung um Jahrzehnte voraus waren, seinem Einfluss auf Literatur und Film sowie der politischen Rezeption seines Werks im 20. und 21. Jahrhundert, unter anderem. Wir laden auf eine Reise durch die Kunstgeschichte ein, um eine der faszinierendsten, komplexesten und umstrittensten Persönlichkeiten der Musikwelt kennenzulernen.

Wir beschäftigen uns mit einem Mann, dessen musikalisches Werk «nur» 111 Kompositionen umfasst, obwohl er hauptsächlich für nur zehn davon bekannt ist – allesamt Opern. Ein Mann, der vor allem als Komponist gilt, obwohl oft nicht erwähnt – oder nicht bekannt – ist, dass er der einzige unter den großen Komponisten war, der sich ernsthaft und tiefgehend mit Philosophie auseinandersetzte.
230 Einzelveröffentlichungen und 35 neue Musikinstrumente
Richard Wagner war nicht nur ein revolutionärer Komponist, sondern auch ein äußerst produktiver Schriftsteller. Vor seinem Tod im Jahr 1883 veröffentlichte er ein beeindruckendes literarisches Werk, das sich über mehrere Jahrzehnte erstreckt und etwa 230 Einzelveröffentlichungen umfasst – mit einem geschätzten Umfang von 4.000 bis 5.000 Seiten. In den 1870er Jahren begann Wagner, seine wichtigsten Texte selbst unter dem Titel «Gesammelte Schriften und Dichtungen» herauszugeben, die in mehreren Bänden erschienen und die Grundlage für die spätere Rezeption seines Denkens bilden. Worüber schrieb er? Über Musik, Kulturkritik, Sozialtheorie, Kunst, Theater, Politik, Religion, Ästhetik, Orchesterleitung und vieles mehr.
Ein weiterer Aspekt seiner musikalischen Kreativität verdient besondere Aufmerksamkeit: Um seine klar definierten akustischen Vorstellungen zu verwirklichen und entsprechende Musikinstrumente zu entwickeln, arbeitete Wagner direkt mit verschiedenen Instrumentenbauern seiner Zeit zusammen. Das Ergebnis dieser Zusammenarbeit waren rund 35 neue Musikinstrumente, von denen viele bis heute verwendet werden. Tatsächlich gibt es ein Buch zu diesem Thema mit dem Titel «Goldene Klänge – Musikinstrumente für Richard Wagner», herausgegeben vom Musikinstrumentenmuseum der Universität Leipzig.
Der große Briefeschreiber
Zudem war Wagner ein leidenschaftlicher Briefschreiber. Die Anzahl seiner Briefe ist so groß, dass es einen eigenen Katalog gibt – das Wagner-Briefe-Verzeichnis (WBV), das ursprünglich 9.030 Briefe umfasste und bis 2021 auf 10.396 angewachsen war. Der erste bekannte Brief, den Wagner im Alter von 17 Jahren schrieb. Die Sorgfalt und Sauberkeit seiner Handschrift spiegelte sich auch in nahezu allem wider, was er tat – sei es in der Musik, in seinen Schriften oder in der Organisation seiner Werke.

Auch die Präzision, mit der er seine Partituren schrieb, ist bemerkenswert. Ein Foto einer Seite der Partitur von «Parsifal», seinem Opus summum, zeigt dies eindrucksvoll. Und das alles in einer Zeit, in der es keine Computer gab und Schreibmaschinen gerade erst erfunden wurden: Alles wurde mit Feder und Tinte auf Papier geschrieben.
«Er ist ein kolossaler Stein, ein Meilenstein»
Sein Erscheinen am Firmament der westlichen klassischen Musik Mitte des 19. Jahrhunderts wurde treffend und knapp vom Chilenen Jorge Dahm in seinem Buch «35 músicos para empezar» («35 Musiker zum Einstieg») beschrieben: «Richard Wagner. Er ist ein kolossaler Stein, ein Meilenstein auf dem bis dahin ruhigen Weg der Theatermusik. Wagner erscheint, und alles gerät in eine Art Aufruhr, aus der sich einige zu befreien versuchen, während andere sich ihr widerstandslos hingeben. Man müsste riesige Bände schreiben, um das enorme, komplexe und übernatürliche Werk Wagners bekannt zu machen. Um seine Bedeutung zu verstehen, genügt es zu wissen, dass über keine historischen Persönlichkeiten mehr geschrieben wurde als über Christus, Napoleon und… Wagner.»
Dahm schließt mit einer sehr treffenden Warnung, die Wagners Werk ebenso anziehend wie herausfordernd macht: «Wagners Kunst lässt uns an der gesamten Bandbreite menschlicher Eigenheiten teilhaben – von Ängsten und Befürchtungen über Größe und niedere Leidenschaften bis hin zur Machtgier und dem Bedürfnis zu lieben und geliebt zu werden. Über allem steht die Liebe, die alles opfert, um als unbestechliche, ehrliche, unvergängliche, schöpferische und ewige Liebe zu bestehen. In Wagners Musik erkennen wir uns alle irgendwie wieder: mal als niederträchtige Zwerge, mal als Monster, mal als Götter. Wie soll man das verstehen? Ach, nur durch Studium – denn ‚Was die Natur nicht gibt, leiht Salamanca nicht.‘ Für Bequeme wird Wagner unverständlich bleiben.»